Repositionierung des globalen Denkens
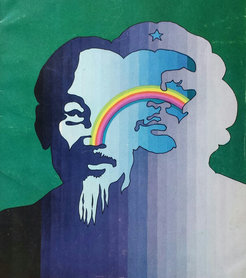
Um den globalen Wandel zu analysieren, müssen wir die Erfahrungen und Perspektiven des Globalen Südens in den Blick nehmen – und zwar nicht allein als Fallstudien, die es zu verwerten gilt. Der Globale Süden ist ein Motor des globalen Wandels und nicht nur ein epistemologischer Blickwinkel, um das Wissen des Globalen Nordens zu dekolonisieren. Über die postkoloniale Kritik des Nordens hinausgehend, wollen wir eine inklusivere und konstruktivere globale Ethnologie erschaffen.
Projekte
Gesellschaftliche Debatten in China als Wissensquelle
Im Mittelpunkt dieses Projekts stehen gesellschaftliche Debatten in China seit den 1990er Jahren – das heißt, Diskussionen in der Öffentlichkeit, unter Bürger:innen, und nicht die Debatten in der Wissenschaft oder Politik. In diesen Debatten finden wir neue Perspektiven auf globale Fragen und Denkweisen. Beispielsweise werfen Diskussionen über Stadt-Land-Beziehungen die Frage auf, ob die institutionelle Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten die Bäuer:innen vor der Volatilität des Marktes schützen könnte. Dies würde die herkömmliche Sichtweise von einheitlichen Märkten und einer undifferenzierten Bürgerschaft als unhinterfragte Normen problematisieren. Zudem weist die Debatte über staatliche Unternehmen auf die Politik der Eigentümsverhältnisse im historisch gewachsenen Kontext hin: wird Privatisierung faire Wettbewerbsbedingungen begünstigen oder wird sie die bereits existierenden Ungleichheiten verfestigen? Wir sammeln gegensätzliche Meinungen zu zehn kritischen Fragen im Format eines kommentierten Lesebuchs, um die Erarbeitung von Forschungsthesen mit globaler Relevanz anzuregen.
Die Frage der Fragen
Genuine Sozialforschung kann ohne die bewusste Formulierung und Problematisierung von Fragen nicht stattfinden: dadurch wird die Forschungsagenda festgelegt. Aber wie und warum werden bestimmte Fragen zum Gegenstand von Forschung – und andere nicht? Warum werden in verschiedenen Teilen der Welt die Fragen unterschiedlich formuliert, und welche Folgen bringen diese Entscheidungen mit sich? Mit diesem Projekt soll ein kritisches Bewusstsein unter Nachwuchswissenschaftler:innen in der Geistes- und Sozialwissenschaften gefördert werden, in dem sie ihre bisherigen Forschungsfragen reflektieren und über die fortlaufende Entwicklung ihrer intellektuellen Agenda nachdenken. In China wurden bereits zwei Workshops zu diesem Thema durchgeführt. Weitere Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit Partner:innen in Indien und Afrika organisiert.
Kartierung von Dissertationsprojekten in der Wirtschaftsanthropologie
Als Experiment zur Wissensethnologie wird die Neupositionierung des globalen Denkens innerhalb der eigenen Disziplin – der Ethnologie – durch eine Inhaltsanalye von Doktorarbeiten des Fachs aus den Jahren 2019 bis 2023 empirisch untersucht. Das Projekt konzentriert sich zunächst auf Arbeiten aus China und den USA, die sich mit Fragen des wirtschaftlichen Lebens im weiteren Sinne befassen, um die Gedanken einer neuen Generation von Wissenschaftler:innen explorativ abzubilden – junge Menschen also, die nicht nur unterschiedlich in der Welt positioniert sind, sondern sich auf verschiedene Weise durch ihre ethnologische Aktivitäten positionieren. Welche Themen und Probleme bewegen sie? Welche konzeptionelleen Ideen und Ansätze sind für die hilfreich oder hinderlich? Über China und die USA hinausgehend wollen wir die Bandbreite der intellektuellen Ressourcen kartieren, die die Ethnologie für die aufstrebende Generation von Denker:innen auf der ganzen Welt bereitstellt, um die Topologien des globalen Wandels zu beschreiben, zu analysieren und zu verstehen.
Outputs
项飙、汪晖, 2022 “导论:提问的自觉”,《提问的自觉》(《区域》系列第9辑), 中国社会科学文献出版社,1-28 [Xiang Biao and Wang Hui. “Introduction: The Question Consciousness.” In The Question Consciousness (Vol 9 in the series of Region), Beijing: Social Science Academic Press. 1-28]
项飙,2022 “双向问题化:中国东北劳务输出和‘跨国主义’范式”,《提问的自觉》(《区域》系列第9辑), 中国社会科学文献出版社, 195-218 [Xiang Biao “Two-way Problematization: Labour Outmigration from Northeast China and the “Transnationalism Paradigm”.” In The Question Consciousness (Vol 9 in the series of Region), Beijing: Social Science Academic Press. 195-218]
项飙,2021 “为承认而挣扎:学术发表的现状和未来”《澳门理工学报》(人文社会科学版)2021年第4期 [Struggling for Recognition: The State of Social Science Publishing and Its Future. Journal of Macao Polytechnic Institute (Humanities and Social Sciences Edition), 24 (4): 113-119.]
Events
Roundtable
“The personal is political” revisited (conversation with Professor Hyun Mee Kim and Professor Wondam Paik, South Korea)
1 August 2022; MPI Halle
Post-1960s culture studies and gender studies are two major inspirations for this department. Addressing personal pain through structural analysis, research in these two fields has changed the way in which many people understand and live their lives. Because this research speaks to people’s concerns, its empirical nuance and theoretical sophistication have informed and supported mobilisation for social change. In return, social engagement has fuelled theoretical innovation. What can we learn from these fields? South Korea is an example of a society in which theoretical debates and social movements are closely intertwined, and it is no surprise that culture studies and gender studies are particularly vibrant there. How have critical intellectuals in South Korea managed to foster a generative interaction between public concerns and intellectual inquiry?
Workshop
Experience, Question, and Scholarship: The Current State and Futures of Chinese Humanities and Social Sciences
11 June 2022; online
Co-organised with Tsinghua Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences
The workshop reflected on the development of research in humanities in China since the end of the Cultural Revolution and explored how a “questioning consciousness” can be fostered among younger researchers. Workshop participants discussed: (1) What questions have Chinese humanities scholars asked in the last half century, what are the historical origin and real-life contexts of these questions, and how are these questions similar or different to those asked overseas? (2) How have scholars’ life experiences impacted the questions asked? How has the sense of history, social change, career paths, professional norms, and academic fashions influenced our research questions? (3) How can scholars in humanities and social sciences raise new questions together?
Roundtable
Economy and Society: Experiences and Experiments from South Asia
12 May 2022; MPI Halle
The latest policy documents agree that the Indian economy is at least 85 percent buried in what is (for a lack of better term) known as the informal economy. But how exactly does the ‘unorganised’ function? In this roundtable discussion, we tracked current research in economic sociology/anthropology in India, focusing on how the dominant discourse of modernisation through economic formalisation continues to sideline research on the importance of social identities, moral understandings of fairness, and ideologies of calculation for the regulation of economic behaviour and institutions. Our purpose was to circumvent tired debates over the dividing lines between formal/informal economies, approaching all economic institutions as socially regulated, and where caste, family, gender, religion, class, and space/region serve as key concepts of analysis, not as after-thoughts.
This roundtable was organised by Anindita Chakrabarti and Andrew Haxby at the Max Planck Institute. It featured contributions from Barbara Harriss-White, Emeritus Professor of Development Studies, Research Associate OSGA, and coordinator of South Asian Research Cluster, Wolfson College; Anindita Chakrabarti, Department of Humanities and Social Sciences IIT Kanpur; Andrew Haxby, Post-Doctoral Fellow, MPI for Social Anthropology Halle; Isabelle Guérin, IRD, French Institute of Pondicherry; Shriram Ventakaraman, Adjunct Assistant Prof. at IIIT Delhi and at IIM-Kozhikod, India; and Jillet Sarah Sam, Department of Humanities and Social Sciences IIT Kanpur.
Roundtable
The Changing Intellectual Landscape in China
6 October 2021; MPI Halle
Co-organised with Berlin Contemporary China Network (BCCN), a joint initiative by researchers at the Humboldt University of Berlin, the Freie Universität Berlin, the Max Planck Institute for the History of Science, the Max Planck Institute for Social Anthropology, and the Technische Universität Berlin.
A seminar by David Ownby, Professor of history at the Université de Montréal, in Montréal, Canada; followed by discussions by Sarah Eaton, Professor of Transregional China Studies, Humboldt University of Berlin; Ian Johnson, Author, Journalist, Senior Fellow for Chinese studies at the Council on Foreign Relations; and Biao Xiang.
Conversation
The Changing Intellectual Landscape in China
Biao Xiang and Pulitzer Prize Winner Ian Johnson joined as discussants. Chaired by Sarah Eaton, Professor at the Humboldt University.
Halle (Saale), 6 October 2021
